
News
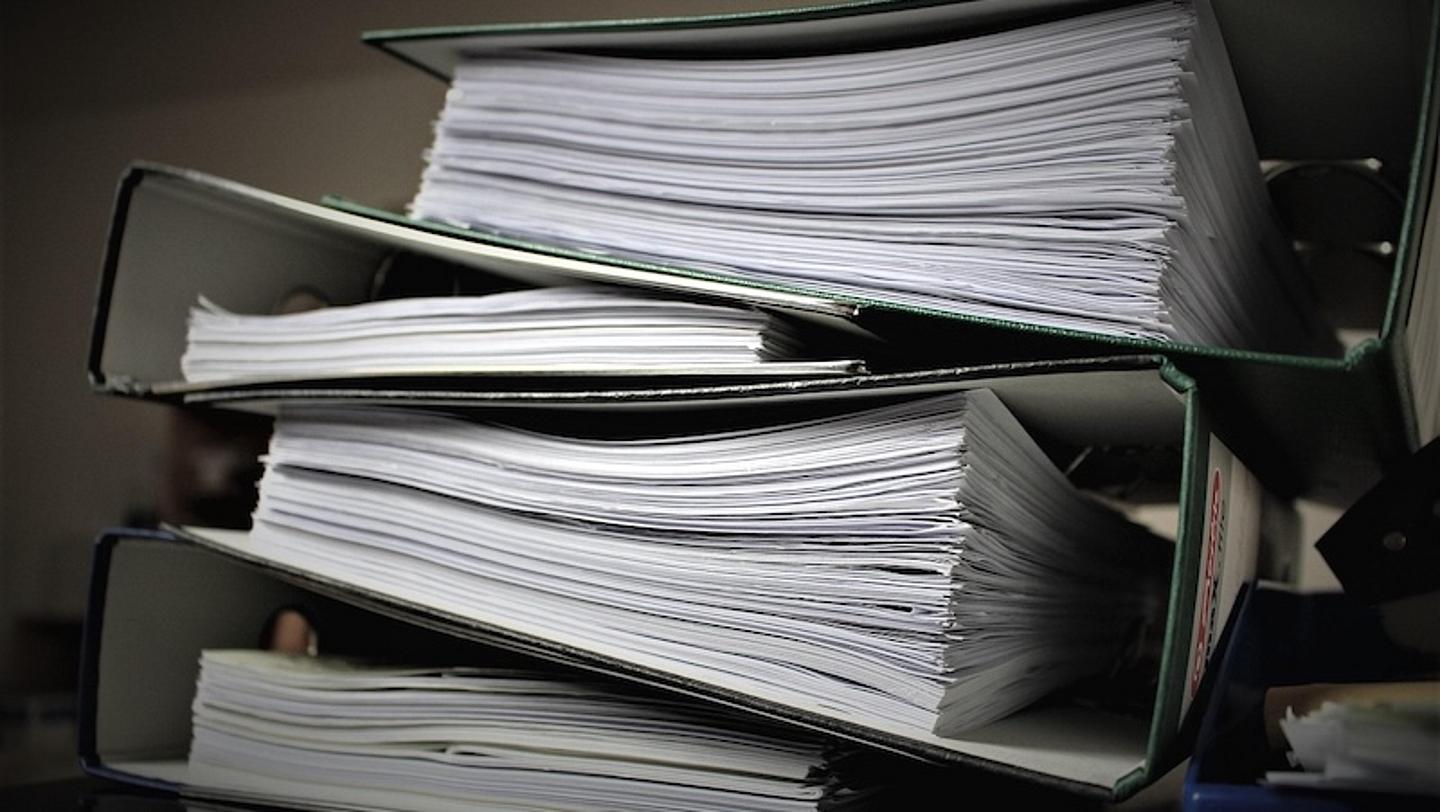
Inhalt
Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz erhalten alle Menschen in Österreich ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen von staatlichen Stellen und öffentlichen Unternehmen. Neben dem Recht auf Auskunft verpflichtet das Gesetz die Verwaltung auch dazu, bestimmte Informationen aktiv in einem zentralen Register zu veröffentlichen. Damit wird Transparenz im staatlichen Handeln erstmals umfassend rechtlich abgesichert.
Das Amtsgeheimnis, eingeführt im Jahr 1925, stellte das letzte Jahrhundert lang ein Hindernis für offene Information dar. Zwar bestand formal eine Auskunftspflicht, sie wurde jedoch durch die gleichzeitige Verankerung der Amtsverschwiegenheit in der Verfassung eingeschränkt. Nach langjährigen Debatten und politischen Verhandlungen wurde diese Regelung nun abgeschafft. Möglich wurde die Reform durch eine Verfassungsänderung, die Anfang 2024 im Nationalrat mit der nötigen Zweidrittelmehrheit der ÖVP-Grünen-Koalition mit Unterstützung der SPÖ beschlossen wurde.
Das neue Informationsfreiheitsgesetz ersetzt nach hundert Jahren die Amtsverschwiegenheit durch ein allgemeines Recht auf Informationszugang. Behörden und staatsnahe Unternehmen müssen Anfragen künftig in kürzeren Fristen beantworten und bestimmte Daten aktiv veröffentlichen. Ziel ist es, mehr Transparenz zu schaffen, Verwaltungshandeln nachvollziehbarer zu machen und den Zugang zu verlässlichen Informationen zu erleichtern.
Davon profitieren nicht nur Bürger*innen, sondern auch Medien und Unternehmen: Journalist*innen können schneller und umfassender berichten, Unternehmen nutzen die Daten für fundiertere Entscheidungen, und die Verwaltung selbst arbeitet effizienter, etwa durch Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit. Transparenz gilt zudem als Mittel, Korruption vorzubeugen.
Dazu zählen Informationen, die für eine größere Öffentlichkeit relevant sind. Das können organisatorische Unterlagen wie Geschäftsverteilungen oder Amtsblätter sein, aber auch Gutachten, Studien, Umfragen, Tätigkeitsberichte oder Verträge.
Das Gesetz betrifft einerseits Bürger*innen, die Informationen haben wollen, andererseits jene Stellen, die zur Auskunft verpflichtet sind. Dazu zählen Bundes-, Landes- und Gemeindeorgane ab 5000 Einwohner*innen, Ministerien, Parlamente sowie staatsnahe Unternehmen, in denen der Staat entscheidenden Einfluss hat (die zu mehr als 50 % dem Staat gehören). Auch nicht hoheitlich tätige Fonds, Stiftungen oder Anstalten unter Kontrolle des Rechnungshofes sind erfasst. Ausgenommen sind börsennotierte Gesellschaften.
Die betroffenen Stellen müssen sowohl aktiv Informationen veröffentlichen – etwa Gutachten oder Verträge über 100.000 Euro – als auch individuelle Auskunftsersuchen beantworten.
Eine der zentralen Neuerungen ist die Pflicht der Verwaltung, bestimmte Informationen ohne vorherige Anfrage öffentlich bereitzustellen. Damit sollen Inhalte, die für die Allgemeinheit von Bedeutung sind – etwa Gutachten, Studien, Tätigkeitsberichte oder Verträge – automatisch zugänglich sein. Gültig ist die Veröffentlichungspflicht für Informationen, die ab Inkrafttreten des Gesetzes (also ab 1. September 2025) entstehen – bereits vorhandene Daten oder Unterlagen müssen nicht rückwirkend veröffentlicht werden.
Grundlage ist ein neues Informationsregister auf data.gv.at, in dem die meisten Verwaltungsorgane ihre Unterlagen einstellen müssen. Ausgenommen sind kleinere Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohner*innen; sie können jedoch freiwillig Daten veröffentlichen. Höhere Institutionen wie Parlament, Rechnungshof oder Gerichte verfügen über eigene Plattformen und stellen ihre Unterlagen dort bereit. Einschränkungen gibt es nur dort, wo ein legitimer Geheimhaltungsgrund besteht, wie etwa beim Schutz der nationalen Sicherheit oder personenbezogener Daten.
Neben der Veröffentlichungspflicht garantiert das neue Gesetz ein individuelles Auskunftsrecht. Jede Person kann nun Informationen bei Behörden oder staatsnahen Einrichtungen einfordern, sofern diese bereits vorliegen. Anfragen sind formfrei möglich – schriftlich, mündlich oder telefonisch – und müssen in der Regel innerhalb von vier Wochen beantwortet werden. In Ausnahmefällen, etwa wenn Dritte angehört werden müssen, kann die Frist einmalig verlängert werden. Wird einem Antrag nicht entsprochen, besteht die Möglichkeit, einen Bescheid zu beantragen, der spätestens nach zwei Monaten vorliegen muss.
Auch hier gilt: Daten dürfen nur dann zurückgehalten werden, wenn gesetzlich festgelegte Schutzinteressen überwiegen, etwa der Datenschutz, die nationale Sicherheit oder wirtschaftliche Geheimnisse.
Die meisten offenen Verwaltungsdaten sind künftig gebündelt auf dem Informationsregister data.gv.at abrufbar – eine Plattform, die bereits jetzt zehntausende Datensätze und zahlreiche Anwendungen bereitstellt. Dort werden künftig verstärkt Inhalte von allgemeinem Interesse eingestellt, zum Beispiel größere Verträge der öffentlichen Hand, Budgetdaten oder Studien. Parallel dazu veröffentlichen manche Institutionen – etwa das Parlament oder die Gerichte – bestimmte Informationen direkt über ihre eigenen Websites. Ab Ende 2025 soll ein eigenes Informationsregister unter data.gv.at als zentrale Anlaufstelle dienen, um die Recherche einfacher und übersichtlicher zu machen.
Grundsätzlich alle Informationen, die bei einer Behörde oder einer staatlichen Einrichtung vorhanden sind – sofern keine gesetzlich geregelten Ausnahmen greifen. Anfragen können ganz unterschiedliche Themen betreffen: von der Begründung einer Gemeindeflächenwidmung bis hin zu den Kriterien für die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen oder auch zu alltäglichen Fragen wie Rezepten in öffentlichen Kantinen. Die Bandbreite reicht also von Verwaltungsvorgängen bis hin zu Details aus dem Behördenalltag.
Ganz gleich, in welchem Format Informationen vorliegen – sie können grundsätzlich angefordert werden. Das betrifft klassische Dokumente wie Gutachten oder Verträge ebenso wie statistische Datensätze, Kartenmaterial, Fotos oder Grafiken. Wer ein bestimmtes Datenformat bevorzugt, kann dies ebenfalls angeben, etwa die Bereitstellung einer Liste in Excel-Form.
So umfassend das Recht auf Information auch ist – es gilt nicht uneingeschränkt. Bestimmte Geheimhaltungsgründe wie nationale Sicherheit, außenpolitische Beziehungen, öffentliche Ordnung oder der Schutz personenbezogener Daten haben Vorrang. Auch Geschäftsgeheimnisse fallen unter den gesetzlichen Schutz. Behörden dürfen Anfragen daher ablehnen, wenn eine Herausgabe dieser sensiblen Informationen schutzwürdige Interessen verletzen würde.
Eine pauschale Geheimhaltung ist jedoch unzulässig: Jede Stelle muss im Einzelfall abwägen, ob und in welchem Ausmaß eine Einschränkung gerechtfertigt ist. Oft reicht es, Daten zu anonymisieren oder Passagen zu schwärzen, um dennoch wesentliche Informationen zugänglich zu machen.
Ein Informationsbegehren kann jede Person (auch juristische Personen) kostenlos einbringen, und zwar formlos – ob schriftlich, mündlich oder telefonisch. Voraussetzung ist, dass die begehrten Daten bereits bei der Behörde vorliegen, eine Neuschaffung von Informationen ist nicht vorgesehen.
So könnte das Informationsbegehren beispielsweise aussehen:
Guten Tag,
hiermit beantrage ich gemäß § 7ff IFG die Erteilung folgender Information:
*Beschreiben Sie die gesuchten Informationen bzw. Dokumente so genau wie möglich und grenzen Sie sie zeitlich so eng wie möglich ein. Geben Sie die gewünschte Form der zu übermittelnden Informationen an, z.B. als Excel-Liste*
Für den Fall einer Informationsverweigerung beantrage ich hiermit einen Bescheid gemäß § 11 IFG.
Mit freundlichen Grüßen
*Name, Anschrift*
Grundsätzlich haben Behörden vier Wochen Zeit, eine Anfrage zu beantworten, in komplexeren Fällen kann diese Frist einmalig um weitere vier Wochen verlängert werden. Bleibt eine Antwort aus oder wird sie verweigert, können Antragsteller einen formellen Bescheid verlangen, der binnen zwei Monaten vorliegen muss. Gegen diesen Bescheid ist Beschwerde beim Verwaltungsgericht möglich. Unterstützung leisten NGOs wie das Forum Informationsfreiheit (FOI), die Leitfäden und Plattformen anbieten, um den Antragstellern bei der Durchsetzung ihres Rechts zu helfen.
Weiterführende Links:
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
Diese Geschichte teilen!
Twitter Facebook WhatsApp
Hinterlassen Sie einen Kommentar!